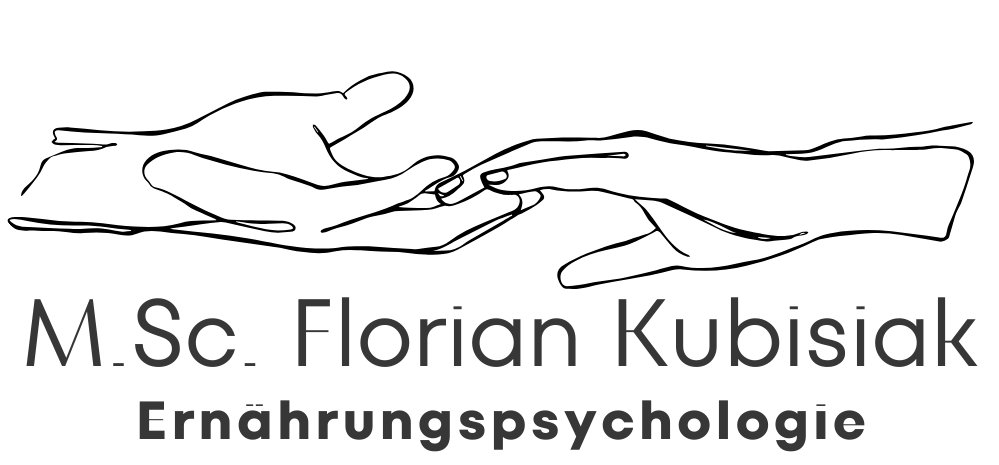Fakt oder Mythos? – Unser Körper verteidigt sein „Lieblingsgewicht“
Viele Forschende gehen heute davon aus, dass der Körper ein sogenanntes Set-Point-Gewicht verteidigt. Egal, wie die biologischen Faktoren im Labor beeinflusst zum Abzunehmen, am Ende gleicht der Körper den Abnehmeffekt an anderer einfach Stelle aus. Und steuert zurück in Richtung seines gewohnten Gewichtsbereichs.
Es ist ein Bereich, in dem sich dein Körper sicher fühlt, weil er nicht befürchten muss, dass ihm die Energie ausgeht. Es wäre immerhin sehr schlecht für dich, wenn dein System keine Energie mehr hätte – nicht einmal zum Überleben. Jede deiner Zellen würde das Atmen einstellen.
Weichst du deutlich von diesem Ideal deiner Energieversorgung ab, ist das System zunächst gestresst. Zum Beispiel nach Diäten oder schnellem Gewichtsverlust. Konsequenz: Der Hunger nimmt zu. Der Energieverbrauch sinkt. Der Körper schaltet auf Schutzmodus. Das ergibt evolutionär Sinn. Energiemangel war lange eine reale Gefahr. Für Menschen, die dauerhaft abnehmen wollen, fühlt sich dieser Mechanismus trotzdem wie Sabotage an.
Die gute Nachricht: Dieser Bereich ist nicht in Stein gemeißelt. Langfristige Veränderungen von Essverhalten, Stressfaktoren und Lebensstil können den Set-Point verschieben. Langsam. Aber real. Um zu verstehen, wie das funktioniert, lohnt sich zu verstehen, wie der Körper seinen Energiehaushalt reguliert.
Der Bauch spricht mit dem Gehirn
Schon während du isst, meldet dein Verdauungstrakt an dein Gehirn.
Diese Signale entstehen zum Beispiel durch:
- Dehnung des Magens
- Nährstoffe im Dünndarm
Einige Botenstoffe wirken schnell.
Sie sorgen dafür, dass du nach einem Teller satt bist.
Andere wirken verzögert.
Sie verhindern, dass der Hunger direkt wieder zurückkommt.
Die Abnehmspritze wirkt letztlich genau an Rezeptoren dieser Sättigungshormone aus dem Darm, dem GLP1-Rezeptor. Natürlich haben diese Wirkstoffe der Abnehmspritze, aber noch anderorts Effekt als nur im Gehirn an der Sättigung.
Hunger ist ein einziges Hormon
Es gibt viele Sättigungssignale.
Aber nur ein Hungersignal.
Ghrelin.
Steigt der Ghrelin-Spiegel, meldet der Körper Hunger.
Das passiert vor allem bei leerem Magen.
Nach dem Essen sinkt dieses Signal wieder.
Ghrelin ist kein Feind.
Es ist ein Frühwarnsystem.
Auch dein Blutzucker mischt mit
Ein Blutzuckerabfall kann Heißhunger auslösen.
Besonders Hunger auf schnelle Energie wie Süßes.
Wenn du zu solchen Schwankungen neigst, kann Regelmäßigkeit helfen.
Nicht aus Disziplin.
Sondern um dein Nervensystem zu beruhigen.
Das Gehirn entscheidet am Ende
Alle Signale laufen im Gehirn zusammen.
Vor allem im Hypothalamus.
Dort wird ständig abgewogen:
- Kommt genug Energie rein?
- Braucht der Körper mehr?
- Oder ist er versorgt?
Je nachdem kippt die innere Waage.
Und dein Hunger verändert sich.
Versuchst du länger unter deinem Energiebedarf zu essen, kippt dieser Schalter und das macht Stress.
Der Körper beginnt zu kompensieren.
Fettgewebe ist kein stiller Speicher
Fettgewebe produziert Hormone.
Eines davon heißt Leptin.
Leptin informiert das Gehirn darüber, wie voll die Energiespeicher sind.
Bei vielen Menschen mit Adipositas wird dieses Signal schlechter wahrgenommen.
Man spricht von einer Leptinresistenz.
Die Folge:
- Der Körper produziert noch mehr Leptin, um den geringere Sensibilität auszugleichen
- Die Spiegel sind dauerhaft erhöht
Leptin wirkt nicht nur auf Sättigung.
Es beeinflusst auch andere Prozesse im Körper.
Welche langfristigen Folgen das hat, ist noch nicht abschließend geklärt.
Aber sicher ist: Eine gezielte Beeinflussung dieses Systems ist therapeutisch nicht effektiv.
Was du daraus mitnehmen solltest
Essverhalten ist kein reiner Willensakt.
Es wird gesteuert durch:
- Hormone
- Nervensystem
- Stress
- Erfahrungen
- Gewohnheiten
Wer das ignoriert, kämpft gegen den eigenen Körper.
Wer es versteht, kann anfangen, mit ihm zu arbeiten.
Genau hier setzt gute Ernährungsberatung an.
Nicht bei Regeln.
Sondern bei den Mechanismen dahinter.